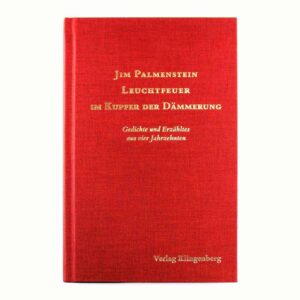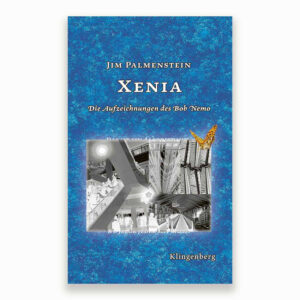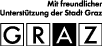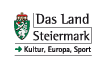Jim Palmensteins Leuchtfeuer im Kupfer der Dämmerung erschien 2018 im Verlag Klingenberg. Der Autor spricht über seine Sozialisation und die Angst überzuschnappen, seine Lieblingslektüre, über die Spielregeln der Gesellschaft, Anthroposophen und Rudolf Steiner, und davon, wie Worte im Traumreich zu einem Eigenleben erwachen.
Der Band »Leuchtfeuer – im Kupfer der Dämmerung« versammelt Gedichte und Erzähltes aus vier Jahrzehnten. Das meiste wird zum allerersten Mal veröffentlicht. Das hat lange gedauert. Warum? Haben Sie Kritik gefürchtet? Wollten Sie überhaupt jemals etwas veröffentlichen?
Ursprünglich wollte ich als Jugendlicher Liedermacher werden. Und ich suchte in Liedern und Gedichten nach Orakeln und Hinweisen, was im Leben wichtig sei. Merkte aber, daß mir die Texte anderer nicht immer paßten. Sie enthielten nicht die Orakel und Zaubersprüche, um mir mein inneres Königreich aufzuschließen.
Mancher denkt doch erst mal, er sei noch nicht soweit, und verstehe die Künstler, die er gerade liest, nicht ganz?
Mag sein. Gedichte, Geschichten, Lieder, die es so gab, waren nicht maßgeschneidert auf mich selbst und meine ganz eigenen Probleme. Sie standen selten in einem Verhältnis zu meinen urureigenen Triumphen, Hindernissen, Glücksmomenten, Konflikten und Freuden. Ich mußte erst mir selber all das aufschreiben, was ich viel lieber – wie für mich geschrieben – da draußen im Radio erlauscht, in der Buchhandlung gesucht, gefunden und gelesen hätte.
Da werden Ihre Fans aber etwas ernüchtert sein, wenn sie hören, daß Sie eben doch nur für sich selbst geschrieben haben. Oder führt Geschriebenes dann doch immer auch ein Stück weit über das eigene Subjektive wieder hinaus?
Genau. Das tut es. So, wie andere Autoren erst meine Saiten zum Schwingen brachten, und mein Denken anregten. Damit ich mir meine eigenen Zauberlieder‐ und Zaubersprüche erfinden konnte. Wenn meinen Lesern nicht alles wie maßgeschneidert paßt, was ich versuche zu sagen, müssen sie selber das Schreiben anfangen. Ob Schlager oder einfachste Lyrik: Literatur ist immer Gespräch. Nicht bloß Lektüre. Eine ewige intersubjektive Auseinandersetzung und Zusammenkunft. Kultur halt. Wenn man genau das hören, sehen, lesen will, was ganz perfekt zu einem paßt, es nicht findet, und es dann nicht selber in die Hand nimmt, nämlich zu malen, zu musizieren, zu schreiben anfängt, kann man lange warten.
Warum wurden Sie denn kein Liedermacher?
Weil man da ein soziales Verhalten leben muß, nämlich dazu entweder eine Band braucht, oder sich erstmal allein in der Straßenmusik gegen ein ganz reales Publikum zu behaupten hat. Man sollte erst einmal lernen, Menschen zu dominieren, sich durchzusetzen, zu kommunizieren. Das Dichten ist da sekundär, und im Auftreten verschmelzen musikalischer und textueller Ausdruck mit dem nötigen Geschick, das Publikum anzupacken. Wenn Sie nicht der Pianist mit der Fliege sein wollen, der bloß die Hintergrundmusik macht, während jeder angeregt herumlabert, müssen Sie Ihr Publikum dominieren, bezähmen und dann zärtlich mit ihm werden. Als Liedermacher, wohlgemerkt. Als Popsänger auch. Die harmloseste Spielart des Populismus.
Hm, verstehe. Konnten Sie sich als Jugendlicher nicht so recht durchsetzen?
Uff! Mal so, mal so. Im Prinzip: Ja doch, ich konnte. Dabei war ich kein Draufgänger. Eher zart und feinfühlig. Während der Grundschulzeit hatte ich große Brüder und Familien meiner Mitschüler, die Lehrer und als Einzelkind obendrein die eigenen Eltern alles in allem eine Zwickmühle rabiat gegen mich stehen.
Zwickmühle?
Ja. Egal, was man tut: Es gibt kein Happy‐End. Und keine nachhaltigen Erfolgserlebnisse. Echte Anlaufstellen gab es nicht. Ein Kind ist der Gegenstromanlage permanent aggressiver Konfrontation kaum gewachsen. Dazu überspannte Erwartungshaltungen, auch wenn die aus einem elterlichen Wunschdenken innigster Liebe kommen. Ich war schon früh allein mit dem Kinderrad unterwegs, in der Hoffnung, wirklich und real einen Zauberer, oder eine Fee zu finden, eine Künstlerin, einen Mentor, wie sie in Büchern vorkommen. Eine Oase der Ruhe, geschaffen durch eine vermittelnde Person, war ein Sehnsuchtsbild. Mein Traum. Das Urbild eines spirituellen Lehrers. Allein, es gab nirgends so jemand. In einem Buch der Eltern über Philosophie las ich nämlich von Meistern und Einsiedlern, vorwiegend im Fernen Osten. Ich hielt Ausschau nach Hütten und einsamen Häuschen, ob da ein Weiser auf einer Bank sitzen könnte?
Waren Sie Schlüsselkind?
Einzelkind. Mit zuviel Nähe zu den Eltern, es war eng zuhause. Ich litt darunter, mich dieser ständigen Nähe nicht entziehen zu können. Dazu gab es keine klaren gedanklichen Konzepte, sondern hoch emotionale Forderungen: „Was aber soll werden?“, „Streng dich mehr an!“, „Du gibst nicht alles!“, „Dein Wille ist zu schwach!“, „Setze dich durch!“, „Erbringe mehr Leistung, tu alles, was die Lehrer von dir verlangen. Ganz!“, „Deiner harret die Brücke, du wirst Penner!“. Wenn einem die übrige Welt unisono genau die gleichen vagen aber harschen Appelle entgegenschleudert, spürt man sich nicht mehr in der Begegnung mit dem anderen. Ohne eine Vertrauensperson, ohne ruhenden Pol weiß ein Kind oder Jugendlicher dann nämlich nicht mehr, was überhaupt los ist. Was die alle von einem überhaupt wollen. Irgendwann kommt da oben nur noch an: Die wollen dich nicht. Die wollen andere, dich aber halt nicht. Egal, was immer du tust, es ist zwecklos. Man wird dann ein Träumer. Und mag nicht so gern vor ein Publikum treten. Zu riskant. Zumindest ging’s mir so.
Haben Sie in Ihrer Jugend unter vielen Verboten zu leiden gehabt?
Eher unter einem Überangebot an Emotionalität. Verzückten Belohnungen, großem Lob folgten derbste Strafmaßnahmen unter Zurücknahme aller Belobigungen. Ein ewiger atemberaubender Zyklus. Entspannte Gespräche lernte ich erst kennen, als ich weit über 25 war. Es gab ja sehr wenig zum Verbieten, außer Rauchen, Trinken in der Öffentlichkeit, laute böse Musik, Comics, Playboy lesen, Pornoheftchen blättern. Ich wollte nur lernen, ein wenig über mich selber zu bestimmen. Mal in der Badewanne ein Bier trinken, dort Radio hören, eine rauchen dazu. Das war nicht drin. Mädchen, die mir erst schöne Augen gemacht hatten, bedauerten mich, nachdem sie mich daheim besucht hatten, und liefen wieder weg. Ich durfte mit Freunden nicht mehr ausgehen, weil ich schlechter und schlechter in der Schule wurde, und mußte fürchten, für verrückt, psychisch krank, für asozial erklärt und eingewiesen zu werden. Es sollte ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden.
Ich war der Amboß, nicht der Schmied.
Mir wäre es andersherum lieber gewesen.
Alles wegen „Schlecht in der Schule“? Oder wegen Rauchens in der Badewanne?
Ja, wegen des Radiohörens, des Bieres und dem Rauchen in der Wanne auch. Man dachte ernsthaft, ich sei durchgedreht. „In der Wanne wird gebadet, nicht Bier getrunken und geraucht.“ Ich kam in eine teure Ganztagsschule in einer anderen Stadt, war täglich vier Stunden unterwegs mit der Bahn. Mußte dafür mein geliebtes Karatetraining aufgeben, und es gab kaum Mädchen dort. Im Tanzkurs für Fortgeschrittene stürzte meine Partnerin beim Jivetanzen unglücklich auf den Hinterkopf und trennte sich daraufhin wortlos von mir. Beendete die gerade entstehende Freundschaft. Ich hätte wenigstens gerne gewußt, ob sie wieder in Ordnung ist. Nichts. Jetzt war ich fix und fertig. Da fing ich überhaupt erst das Rauchen an. Und ging dann trotz Verbot in Wirtshäuser. Zu Freunden. Klar versuchte ich, das große Wort zu führen, da wo es noch ging. Lungerte in der verbliebenen Freizeit nur noch herum. Was wohl das Schlimmste war, das begreife ich heute erst: Ich verlor irgendwie den Zusammenhang mit den Spielregeln der Gesellschaft.
Wurden Sie etwa kriminell?
Absolut nicht. Ich war halt am Nörgeln, Nöhlen und Schimpfen, und dazu melancholisch. Meine ganze Situation, mein Dasein vermochte mich nicht mehr davon zu überzeugen, daß das Leben lebenswert sei. Ich fand, daß alles, was ich anfaßte, zu purer Scheiße wurde. Ich war der Amboß, nicht der Schmied. Mir wäre es andersherum lieber gewesen. Es wäre mir ein Graus gewesen, anderen Menschen Gewalt anzutun, andern etwas wegzunehmen, was ihnen gehört. Andere Menschen zu bedrohen? Furchtbar. Nein. Nur, ich konnte mich nicht instinktiv mit Normen verbinden, um diese als Werkzeuge und Maßstäbe im Zusammenspiel der Gesellschaft und des Marktes zu begreifen. Ich verstand zeitweise das Spiel nicht mehr. Dann warf mir jeder vor, ich sei selber verantwortlich für meine Unzufriedenheit. Da allerdings konnte ich wütend werden. Verbal.
Sie waren ein verbitterter junger Mensch?
Absolut. Während meine Altersgenossen im Zuge ihres Pubertierens beispielsweise Mode immer mehr als ein Verkleidungsspiel verstanden, was ihre Kreativität herausforderte, einen eigenen Stil zu entwickeln, und weitere Konventionen, Frisur, Zimmereinrichtung, Topfpflanzen meinetwegen, Poster, Möbelstücke zu nutzen begannen, um Signale zu senden, Bedürfnisse zu wecken und anzumelden, fehlte mir dieser Zugang komplett. Auch über Ausbildungswege wurde offen und interessiert diskutiert. Da fühlte ich mich schon nicht mehr kompetent und gefragt, und zog mich zurück. Jedoch instinktiv. Wie ein Tier. Was gewisse Geräusche und Lichtverhältnisse nicht erträgt.
Hatten Sie sich ab da nicht selbst aus der Gesellschaft ausgeschlossen? Ein Stück weit zumindest?
Klar. Beides bedingte sich ab da wechselseitig. Ich witterte hinter allem nur Anpassung und Domestikation, Betrug. Konsumfallen. Ausbeutungsversuche. Unterwerfungs‐Mechanismen. Eigentlich war das keine Gesellschaftskritik mehr, sondern ein Bemänteln meiner Schüchternheit und Isolation. Das haben damals nicht einmal Erwachsene bemerkt. Sie dachten: „Er rebelliert“. In Wirklichkeit stand ich mit dem Rücken zur Wand. Hinter dieser Wand aber ging es den Abgrund runter. Das spürte ich. Das spürten auch andere, denen das genauso erging. Das ging damals schon vielen so.
Ihren Gedichten und Texten aus dieser Zeit merkt man das nicht an. Die Worte stammen von einem nachdenklichen und eher sozial überreflektierten jungen Menschen. Der weiß, wo er selbst sich vom Schlurian, einer Figur, die in Ihrem Buch ja an mehreren Stellen vorkommt, unterscheidet. Wem konnten Sie sich in dieser Situation anvertrauen? Gab es sowas wie ein Licht am Ende des Tunnels, was sich eben nicht als ein weiterer entgegenkommender Zug entpuppte?
In ganz entscheidenden Situationen unseres Lebens scheint das eine Art Gesetz zu sein: Da ist dann niemand da. Und es geschieht nur noch Unerwartetes. Alle Pläne, wenn es welche gibt, scheitern. Nicht selten ist das Unerwartete wohl eine Chance, daß es weitergeht. Es kommt wieder mal was Gutes dabei heraus. Wenn nicht, ist es halt vorbei. Dann ist das Unerwartete eine weitere Harpune in den Rücken des Wals. Soll vorkommen.
Uff! Gut, Sie haben überlebt. Okay. Liedermacher aber wurden Sie nicht.
Ich fand keine Ruhe mehr, Gitarre zu üben und zu spielen. Ich zog zuhause aus, wohnte zur Miete, plötzlich war das „Ruhestörung“. Eine Gitarre ist schließlich keine Bohrmaschine!
Haha! Genau, Löcher bohren für Regale etwa darf man schon mal tagelang.
Gitarre war vorbei. Es ging erstmal nur noch um eins: am Leben bleiben, stabil bleiben, nicht einknicken, aufrecht gehen, keine Schwäche zeigen. Um nicht entmündigt zu werden. Die Risse in meiner Fassade kitteten Jugendfreunde, bei denen ich das Lachen lernte. Das Lachen! Jugendfreunde und Lachen! Welch ein Geschenk. Dafür danke ich. Schreiben ging immer. Ich tat es für mich allein. So nebenher. Und ich las viel. Alles mögliche.
Das muß man auch erstmal verarbeiten, was Sie da so erzählen … Eine Fassade aufrechterhalten? In den „Leuchtfeuern“ taucht der Begriff „Institutionen des Höchst Schlechten Gewissens“ auf … da ging es nun doch ums Dominieren, um Selbstbehauptung, ums Managen dieser schlechten Gefühle gegenüber anderen, und um eine Art der Manipulation.
Schwer zu sagen. Wer bricht schon gerne einfach so zusammen. Ja, wir alle hatten damals andauernd wegen irgendetwas ein schlechtes Gewissen. Jugend ist für mich heute synonym mit „schlechtem Gewissen“. Kaum zu glauben, daß das anders gehn kann. Haha.
Das stimmt …
Ach, es gibt schlimmeres. Etwa, wenn ein Leben in einem Sozialen Brennpunkt seinen Anfang nimmt, wo für Jugendliche die Pubertät mit Wohnungslosigkeit, sich prügelnden Erziehungsberechtigten mit Suchtproblemen, Jugendamt und ähnlichen Katastrophen beginnt. Manche schaffen das. Was das wohl für eine Haltung braucht, und für einen Lebenswillen!? Für mich war die Sache subtiler. Ich war wohlbehütet. Das heißt, ich war ein geplantes Kind. Ich hatte gesundes Essen, Fleisch und Gemüse, Quellwasser aus Flaschen zum Trinken. Und ein Bett unter einem Dach. War festgesetzt, fast immer etwas festgefahren. Und ziemlich schlecht beraten.
Sicher. Der Arbeitsmarkt hat so seine Ansprüche, und er fordert knüppelhart seine Normen ein. Da braucht es Flexibilität und rasche Reaktionsfähigkeit. Eine sehr spezielle Empathie, Aufgeschlossenheit. Aber leider auch Beziehungen, beste Schulabschlüsse, entsprechende Referenzen …
Ein verdammtes Labyrinth, ich suchte wie ein Wahnsinniger nach Ausgängen, und wurde mit Vorwürfen und vollkommen unrealistischen Ratschlägen eingedeckt. Ich solle ‚loslassen‘, und am besten ganz ohne Geld einfach an der Autobahn lostrampen. In den Süden, oder so. Darüber schrieb ich dann einen Song. Gott würde mir, wenn ich nur Vertrauen hätte, alles nötige zusenden. Hieß es. Andere rieten mir, einen Sexshop zu eröffnen, oder eine Champignonzucht in einem eigens dafür gemieteten Keller zu beginnen. Einmal wollte mich ein Mann für seine Heti‐Bar, einen Swinger Club, wie man das dann später nannte, als „Mogli“. Das konnte ich mir aber alles wirklich nicht vorstellen …
Gab es nirgends Angebote für Fortbildung, Möglichkeiten zu reflektieren?
Es gab nur Appelle: „Leistung!“, „Strengt euch an!“, „Ihr faulen Säcke!“ – Man biß die Zähne zusammen, denn man wäre gern klüger, gebildeter, entspannter gewesen. Ein Freund wollte aus religiösen Gründen den Militärdienst verweigern. Bei der Gewissensprüfung fragte man ihn, was in unserer Stadt gerade wäre. Er hätte nur das Wort „Lutherjahr“ sagen müssen. Überrumpelt entfuhr es ihm: „Woher soll ich das wissen?“ Damit landete er bei der Truppe, konnte sich dort nicht sozialisieren, hatte nur Ärger. Einer Freundin, die Soziales Jahr in einem Altenheim machte, kamen sie auf die Schliche, daß sie zuvor während einer pubertären Krise ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen hatte, und darum einige Zeit in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht war. Ihr Sozialarbeiter hatte nicht dichtgehalten. Sie war sofort von allen Tätigkeiten suspendiert, durfte Alte Menschen nicht mehr berühren und versorgen, und sollte nur noch putzen. Auch sprach jetzt das verunsicherte übrige Personal nicht mehr mit ihr. Sie brach in Tränen aus, und bekam einen Wutanfall. Da wurden Sanitäter alarmiert, man warf sich auf sie, gab ihr eine Betäubungsspritze, und brachte sie in die Psychiatrie zurück. Erstmal. Mir gingen alle diese Dinge sehr nahe. Andere in meinem Alter sagten da bereits: „Was geht mich das an? Das ist das Leben! Hauptsache, ich krieg meines auf die Reihe!“!
Naja, man ist wirklich nicht für alles verantwortlich. Mancher hält sich heraus …
Ich hatte in der Badewanne geraucht, …
Haha, ich versteh’ schon!
… und war tief verunsichert, ob sowas schon ausreichen könnte, eine Kaskade auszulösen, die mich in die Geschlossene bringt. Ich stand Menschen in Lebenskrisen immer näher, als den Siegern, die den Verlierern ohnehin im Abwehrreflex Schuldgefühle implementieren. Uns wurde immerzu und überall eindringlich erklärt, wir hätten endgültig verschissen. Unsere Interessen wurden alle ‚zur verlängerten Spielwiese‘ und zum No‐Go erklärt. Wir fühlten uns beschissen bei jedem Comic oder subkulturellem Buch, was wir lasen, wenn es nicht vom Bildungskanon abgesegnet war, oder anderweitig für nützlich, zweckmäßig, brauchbar erklärt worden war.
Macht Verbotenes denn nicht viel mehr Spaß?
Natürlich. Schon. Für eine Weile. Mich aber nervte es, weil so auch gute Sachen nicht ernst genommen wurden. Vielleicht war manches nicht verboten genug, oder falsch verboten. Ja, ich glaube, nicht verboten genug. Manches outlaw‐Mäßige wurde für unendlich lächerlich erklärt, und man war immerzu peinlichst verunsichert. Oft bis zur Verblödung verunsichert. Und dieser Zustand ist unproduktiv!
Geht das präziser? Inwiefern verblödend?
Balz. Konkurrenzgebaren. Unruhe. Es ging nur darum, herauszufinden, was korrekt oder was angesagt war. Inhaltliche Auseinandersetzung? Fehlanzeige. Im bildungsprekären Milieu kennt man ein Heranreifen nicht. Erklärungen, Einführungen zu komplexeren Themenbereichen sind exklusive Mangelware und Machtinstrumente. Der Underdog soll inkompetent bleiben und schlechte Arbeit abliefern. Er wird verarscht, nicht aufgeklärt. Und merken soll er’s auch nicht. Hahaha. Das schafft Mißtrauen und Scham. Auch Wut. Und Angst. Und dies alles ist unproduktiv.
Das alte Lied. Die Linke nennt es Klassenkampf. Aber oft ist das der normale Kampf ‚Jeder gegen jeden‘: Ich weiß Bescheid, du aber bist dumm. Und selber schuld. Und das soll auch so bleiben, nicht?
Just als ich mit Vegetarismus experimentierte, bot man mir eine Lehrstelle als Metzger an. Ich bin absolut nicht schwindelfrei, ein Angebot für eine Dachdeckerlehre hatte ich sofort. Vielleicht wäre das mit dem Metzger ja richtig gewesen? Mmmh. Klar arbeitete ich. Als Putzkraft bei der Wohlfahrt. Später als Zivi In der Altenpflege.
Sie waren isoliert? Obwohl Sie Freunde hatten?
Gefühlt immer sehr, sehr einsam. Gerade unter Menschen. War ich wirklich mal alleine, fühlte ich mich befreit. Kam selten vor. Die Verhältnisse waren eng. Wo soll man hin? Das macht einsam. Vielleicht sind wir das ja alle. Es gibt da einen Song von Maxim, „Einsam sind wir alle!“
Hm, klar … ja, ich kenne diesen Song …
Ich mußte versuchen, mich aus der Verinnerlichung einer fatalen Mischung aus zärtlicher Überbehütung, „Die Welt ist brandgefährlich!“, und rabiater Unterdrückung , „… und du taugst zu gar nichts, bist nur patzig, frech und bist zu schwach und zu nett für den Überlebenskampf!“, wenigstens ein Stückchen zu befreien. Da war ich nicht der einzige. Die Vorzimmer zu Bewerbungsgesprächen für äußerst begrenzte Stellen glichen überfüllten Arztpraxen während einer Epidemie. Allein, ich war komplett unerfahren. Wenn ich was sagte, fingen erwachsene Autoritätspersonen manchmal laut im Chor zu lachen an, und ich wußte nicht, warum. Geht mir manchmal heute noch so. Ein Simplex war ich. Das Hanauer Kalb.
Da wäre das mit dem Metzger vielleicht wirklich eine Tür gewesen?
Als Hanauer Kalb? Ja, haha. Ich wäre Kalbsleberwurst geworden!
Haha! Nein, aber um die Hüllen des Überbehütetseins loszuwerden, und zugleich die Erfahrung zu machen, einem Job jenseits aller Familienmaßstäbe noch was Gutes abzugewinnen?
Ja, bestimmt! Als ich geboren wurde, lag über der Generation meiner Eltern und Großeltern ein großes Aufseufzen, Der Krieg ist zuende. Die Armut und Hungersnöte sind ausgestanden! Wir haben Freiheit, wir haben Demokratie. Wir haben endlich satt zu essen! – Ich wurde gewollt und wurde sehr geliebt! Aber wie weist man einem Menschen Wege, ein freier selbständiger Mensch in einer freien Welt zu werden? Ich war zur Einwegflasche erklärt worden. Ich sah, wie gutbürgerliche Familien sich von ihren Jungs und Mädchen lossagten, denen es genauso erging. Und da war wirklich erstmal … nichts … Wer den vorgeschriebenen Lebenslauf nicht erfüllen konnte, war oft sowas wie ein lebender Toter. Mancher zog sich diesen Schuh an. Dein Leben ist zuende, was die nächsten zwei oder zehn oder zwanzig Jahre noch kommt, ist nur noch der Abspann deines Lebensfilms, einem Film, den keiner mehr sehn will!

Man erwartete von Ihnen konsequent einen sozialen Aufstieg, als Einzelkind aus relativ einfachen Nachkriegs‐Verhältnissen? Stellvertretend für eine ganze Ahnenreihe und vorbildlich für die Familie? Und Sie versagten schon am Gymnasium. Kann man das so sagen?
Absolut. ‚Akademiker oder Tod‘. Das lag in der Luft. In vielen Familien, wo die Väter nach dem Krieg oft mit viel gewissenhaftem Bemühen einen Beamtenstatus erlangt, oder den Sprung in einen Firmenvorstand geschafft hatten. Manchen Söhnen und Töchtern ist der Aufstieg wirklich gelungen. Vielen aber nicht. Daher wäre der Metzger wohl wirklich eine Tür gewesen. Sie können jemandem das Einmaleins einprügeln. Nicht aber das Kreieren komplexer mathematischer Formeln. Ich war nun mal kein Blitzgescheiter. Sonst wär’s vielleicht sogar gegangen. Weiß man nicht. Aber ein Rindvieh oder ein Schwein zerlegen und thekengerecht verpacken! Das hätte ich wahrscheinlich gekonnt. Man machte damals noch weniger Akkordarbeit im Fleischerhandwerk.
Sie haben dann Ihre Heimatstadt verlassen, und doch noch viel Unerwartetes erlebt, was Ihren Horizont dann glücklicherweise nach und nach erweiterte. Es verschlug Sie vornehmlich in die Schweiz, wo Sie auch verheiratet waren. Sie wohnten bei Tuttlingen in der Schwäbischen Alp, bei Basel, in Freiburg, Zürich, Locarno, Ascona, in Konstanz und Kreuzlingen, dann gingen Sie nach Helsinki und lebten bei Orimattila, einem Städtchen nahe der finnischen Stadt Lahti. Sie kehrten nach Deutschland zurück, lebten in Mainz und Heidelberg. Sie beschäftigten sich mit Naturkost, Schafen und ein wenig mit Pferden sogar, mit der Betreuung seelenpflegebedürftiger Menschen, mit der Anthroposophie und insbesondere mit Eurythmie und Sprachgestaltung, ferner studierten Sie Geschichte und Germanistik. Dabei trafen Sie zahlreiche Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und unterschiedlichsten Lebenskrisen. Sie sagen, Sie hätten zu allen diesen Zeiten und auch später nebenher immer ein wenig geschrieben. Und gern gelesen. Was haben Sie da gelesen?
Einfache Sachen. Ich liebte Wilhelm Busch über alles. Dann sehr viel von Michael Ende: Jim Knopf und Momo, Der Spiegel im Spiegel. Ottfried Preußlers Hotzenplotz. Und Max Kruses Urmel. Und natürlich Hermann Hesse, der ist auch leicht zu lesen, aber schon anspruchsvoller, sagt man. Dann etwas Peter Handke, wo mir Als das Wünschen noch geholfen hat besonders gefiel, da mochte ich jedes Wort. Und Hans Christian Artmann, mit all seinen phantastischen Metaphern, wo ich beim Lesen wie berauscht wurde. Übersetzungen von Kurzgeschichten von Charles Bukowski. Ich liebte auch Ernest Hemingway, sein auf „nüchtern“ machendes, scheinbar trockenes Pathos. Und vor allem las ich immer gerne Henry Miller, auch im Original, und Anaïs Nin.
Alles Wesentliche verdichtet sich nur noch zwischen den Zeilen. In solchen Schwebezuständen entstehen Alpträume, aber auch orientierende Träume. Wenn man in solchen Situationen versucht, vernünftige Erklärungen abzugeben, tönen die wie Glocken ohne Klang. Hier kann ich nur versuchen, mehrschichtig und auf keinen Fall mehr rational zu formulieren. Wenn Glocken erklingen sollen, müssen sie frei schwingen können …
Sicher auch Rilke? Und an Hölderlin kommt man doch auch nicht vorbei?
Hölderlin verwechselte ich mit 25 Jahren öfter mit Novalis. War das Romantik, oder deutscher Idealismus? Was kümmerte mich das? Aber ein Zwiebelbaguette zu einem Altbier war was Feines! Dann eine gute selbstgedrehte Zigarette! Rilke kannte ich kaum. Auch den noch zu meiner Zeit sehr wichtigen Thomas Mann nicht. Mein lieber Scholli: Viel zu viel Text Text Text. Bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich außer Hesse kaum etwas aus dem damaligen bürgerlich literarischen Bildungskanon lesen mögen. Die ehrfürchtigen und gottsuchenden Knaben Hermann Hesses kannte ich, denn ich war zu meiner Ministrantenzeit selber einer von ihnen, und bin es auch geblieben bis auf den heutigen Tag. Die harten Fakten aus dem Leben verkrachter Existenzen, die in Bukowskis Kurzgeschichten vorkamen, hatte ich in unserer Kleinstadt jeden Tag vor Augen. Von Hölderlin kannte ich nur zwei Gedichte, Mitte des Lebens und Hyperions Schicksalslied. Schelling, Fichte, Hölderlin, Hegel? Mir fehlte zu solcher Lektüre der innere Frieden. Die Schule und ein Arbeitgeber würden sagen „Die Fähigkeit zur Konzentration!“ Was sehr gemein ist. Denn manchem fehlt der Frieden, und ein echtes Gefühl von Sicherheit. Dann käme auch die Konzentration.
Aber irgendwann haben Sie dann doch alles von Rilke gelesen, nicht?
Später dann, ja, in einer stabileren Lebenssituation zum Beispiel alles von Rilke und dazu andere Schriftsteller und Dichter, etwa des fin de siècle des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts zu lesen, das war zuerst ein richtiger Rausch! Dann aber bald schon eine Reizüberflutung, die sich sehr negativ auf die Spontaneität meiner Sprache auswirkte. Ich schrieb eine Weile nur noch wirres stammelndes Zeug, und gab alle Versuche zu dichten oder gar zu schriftstellern komplett auf. Ich las alle Poesie ohne die nüchterne Distanz des Forschers, ergab mich den Versen der Dichter. Plötzlich war sie wieder da: Die Angst, vielleicht unbemerkt von mir und andern, geisteskrank zu werden. Wie damals beim Rauchen zu einem Bier in der Badewanne. Es war aber wohl eher die Angst, zu individuell zu werden. Die Gabe jeglicher Anpassungsfähigkeit zu verlieren. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo die eigenen Grenzen sind. Ist da noch ewig viel Luft? Oder sind sie bereits längst überschritten, die Grenzen? Wird man verschroben? Kann man seine Entwicklung noch normativ kommunizieren? Oder ist man schon seelisch krank? Ist man Hypochonder, oder bräuchte man echte Hilfe? Das ist kein schönes Gefühl, so in der Schwebe zu sein …
Und suchtest das Gold im Leben
Aus dem Text „Stadt im Fußballwinter“
ohne Goldesel bearschtätscheln zu müssen
Gestanden auf Autobahnbrücken
und wahnsinnig sehnsüchtig nach Erinnerung
ganz ganz weit und tief hinein: bis es zieht
auf der Spur eines neuen Weltbildes …
um Augen zu schließen
vor blendender Gegenwart, ein pfeifender Teekessel
Formloses tanzt ständig,
während Weltbilder brechen und zerfallen
im Schmerz des „Schöpfers“.
Was ist dir lieber?
Sie sagen es, Herr Palmenstein. Manchmal gibt es Momente, da fehlt einem scheinbar oder tatsächlich ein „Guru“ und Lehrer, der absolute Mentor, der irgendwie ein Mittelding aus Therapeut, Trainer, Coach und großer Bruder ist, ein Lotse, der einen sicher durch Engpässe oder über Hürden begleitet. Auch Sie kannten Menschen, die Ihnen solche Bedürfnisse zu erfüllen suchten, die Ihnen sich selbst und die Welt erklärt haben?
Das waren sehr spezielle Begleitpersonen und Mentoren, deren Schwächen oder Unzulänglichkeiten sich mir schon recht bald offenbarten. Die mir allerdings in ihrem jeweiligen Fachgebiet eine Menge beibringen konnten. Manche Erkenntnis und Methode ist nicht übertragbar, und differenziertere Bewältigungsstrategien von Lebenssituationen sind immer konstitutionell gebunden. Wir können das Denken und die Reaktionsmuster anderer Menschen nicht nachäffen, wenn wir mit den eigenen Künsten am Ende sind. Eine Weile geht das vielleicht so etwas Ähnliches wie gut. Das wäre ein Riesenfaß, wollten wir es aufmachen: Der „Guru“, der Coach, und die individuelle Freiheit. Von Hypnose und freiem Denken. Von Autodidakten versus verbrieften Meistern und Akademikern. Und ab wann wird die Verpflichtung gegenüber einem Mentor zur Fessel und zur Last? Wo beginnt die manische Selbstüberschätzung?
Sie haben auch einiges von und über Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Romano Guardini, Heidegger, Hannah Arendt, Carl Jaspers, Erich Fromm, Theodor Adorno gelesen. Kant und Fichte sogar motiviert in Angriff genommen, oder?
Das sind doch Philosophen und nur einige waren auch ansatzweise Schriftsteller. Da war ich als Tourist unterwegs, in den meisten dieser Werke. Habe nur geschaut, wie das Männlein, was zum ersten Mal im fernen Ausland in einer großen Kathedrale steht. Klar hatte ich Hoffnung, auch das noch bald bewältigen zu können, aber vergebens. Um sicher zu sein, große Philosophen zu verstehen, bin ich weiterhin dringend auf gute Sekundärliteratur angewiesen.
Sie haben sich wie ein Wilder in Literatur, Geschichte und Germanistik gestürzt! Ab da war vorerst fertig mit Schreiben und Dichten?
Da war Ende der Fahnenstange! Zuvor hielt ich mein bißchen Schreiben für was Originelles. Ich schrieb längst keine meiner Wort‐für‐Wort‐Meditationen mehr. Ich schrieb gern Briefe an Bekannte. Als die immer länger werden wollten und ich kein Ende mehr finden konnte, merkte ich gerade noch, daß da was nicht stimmte.
Was stimmte nicht mehr?
Eigentlich ganz einfach: Ich wollte mich nicht damit abfinden, daß es Distanzen und Grenzen gibt zwischen uns Menschen. Man kann nicht alles erklären, immerzu Brücken schlagen, wenn Kontinente beginnen auseinanderzudriften. Solche Brücken werden immer länger. Und die Erläuterungen der Unterschiede, unverschuldeter Distanzen immer komplexer. Man rechtfertigt und erklärt sich zu Tode. Wo einst ein Dialog stattfinden konnte, bleibt man jetzt auf unheilbaren Selbstgesprächen sitzen. Auf Elfenbeinbrücken, die ins Nichts führen. Zurückgezogenheit ist notwendig, aber menschliche Begegnungen sind es auch. Wenn Menschen sich kennenlernen, entfremden sie sich immer mehr. Bis zu dem Punkt, an dem es zum Bruch kommt. Zwischen den Kontinenten aus Wissen und Gewohnheiten.
Ist das nach Ihrer Ansicht zwangsläufig so, daß ein intensives miteinander Bekanntwerden und sich Kennen einander entfremdet?
Ja, unbedingt! Leider scheint das so zu sein. Wenn sich Fremde plötzlich für uns interessieren, kommen uns ganz neue Gedanken, und mit einem Male dürfen wir wieder Sachen, die wir bei uns eng vertrauten Mitmenschen verlernt und aus Rücksicht oder Scham ganz abgelegt haben. Aber wie bleibt man sich fremd? Da liegt vielleicht ein Schlüssel zum Ewigen Leben, was das Zwischenmenschliche betrifft.
Wollen Sie von den Menschen geliebt werden?
Kein Kommentar …
Lieben Sie die Menschen? Würden Sie sich als einen Menschenfreund bezeichnen?
Ach, das ist ein heißes Pflaster. Das von mir sagen zu können, war lange mein Traum. „Ich aber, ich bin ein Philanthrop!“ Schauen Sie: Menschen, die öffentlich von sich behaupten, sie wären es, sind fast immer reich, haben überdurchschnittlich Erfolg. Und sie sind gesund. Ist der Zenit ihrer Macht überschritten, werden plötzlich Stimmen laut. Man bezichtigt sie des Machtmißbrauchs, der Nötigung oder Erpressung. Am Ende weiß niemand wirklich, ob die Vorwürfe irgendwelchen Tatsachen entsprechen, oder Verleumdung sind …
So kann man auf jeden Fall sagen, daß man sich unter Menschen vorsichtig bewegen sollte.
Hm. Na gut. Und würden Sie sich als Schriftsteller bezeichnen? Oder eher als Dichter?
Mich bezeichnen? Besser nicht. Das müssen andere Menschen entscheiden. Keine Institutionen. Und ich auch nicht. Oder sagen wir so: Je mehr ein Mensch als ein Mensch mich einen Dichter nennt, desto eher würde ich versuchen können, es ihm zu glauben. Schriftsteller? All das sind so Worte, die mich erschrecken. Die ich nicht zu bedienen wage. Als ich ein Kleinkind war, hatte meine Tante eine Toilettenspülung, wo der Wasserkasten knapp unter Decke des engen Räumchens angebracht war. Da war an einer Kette ein Holzgriffel. Wenn man da dran zog, polterte das Wasser so laut herunter, daß ich oft fürchtete, ich hätte vielleicht zu fest gezogen, und jetzt stürzt das Haus ein. Da hab ich dann nach jemand gerufen, weil ich nicht allein sein wollte, wenn das Wasser herunterdonnerte. Es gibt so Begriffe, die schüchtern mich ein. Die will ich nicht betätigen in Bezug auf meine Person. Nachher stürzt die Welt über mir zusammen …
Ist Poesie, Dichten, wenn ich nun doch mal diese Worte nutzen darf, nicht auch so etwas, wie etwas Spirituelles? Eine Art Suche nach Gott? Ich meine jetzt nicht die explizit spirituelle, oder religiöse Dichtung selbst, versteht sich.
Dann wäre der Dichter ein Pfarrer, ein Priester. Da haben wir es ja. Das ist alles ein heißes Pflaster. Wenn der Begriff „spirituell“ in den Raum gerufen wird, höre ich als Echo den Begriff „elitär“ zurückkehren. Das alles ängstigt mich. Es fängt mit Balz an, und endet in Machtpolitik.
Sie wollen also weder Heiler noch Lehrer sein?
Nach Friedrich Georg Jünger liegt jenseits des Sagbaren das Totenreich, es beginne an der Grenze zum Unermeßlichen Schweigen. Das steht ganz vorne in der Vorbemerkung der Gespräche, und im Totenreich Unermeßlichen Schweigens könne der Unglückliche Linderung erwarten. Hier, an dieser Grenze zum Totenreich, zum Unermeßlichen Schweigen habe ich immer meine besten Worte gefunden. Dort konnte ich mich selbst von der anstrengenden Begegnung mit Werken der Großen Literatur heilen. Und auch einige meiner Texte wieder gut finden, denn wozu sich immerzu mit anderen vergleichen? Was soll all das „sich kleiner Fühlen“, „sich größer Fühlen“ als andere oder anderes? Oder von der andern Seite kommend, all das Einfordern einer „Augenhöhe“ zu irgendetwas. Das mit Eifer sich Mühen, „sich jaa für nichts Besseres zu halten“. Einfach dasein. Das genügt. Die Frage, ob dieses Buch, ob die Leuchtfeuer, als Heilungsmöglichkeit, als Belehrung einen Nutzen bringen, ist sicher ein bißchen ungesund.
Ja, die Frage nach einem Nutzen ist sich gleich mit der Frage „Wofür überhaupt?“ Eine Frage, die nur ins Bodenlose führen kann, vor allem dann, wenn es um Gedichte und Erzählungen geht. Aber dennoch, schon wo Sie jetzt das Zitat des „Totenreichs“ aus einem Buch von Friedrich Georg Jünger anführen, und das Zitat des „Unermeßlichen Schweigens, welches allein Linderung für den Unglücklichen bringt“: Gibt es eine metaphysische Dimension der Poesie, mit der Sie liebäugeln? Auch Rudolf Steiner findet in ihrem hier vorliegenden Band Erwähnung.
Also gut. Was ich unter Poesie verstehen würde, und auch für meine Poesie gilt das: Sie ist dem Traum näher, als dem Wachbewußtsein. Es ist, als würden die Worte zu einem Eigenleben erwachen und miteinander zu sprechen beginnen. So wie im Märchen vom kleinen einbeinigen Zinnsoldaten und seiner geliebten papiernen Tänzerin von Hans Christian Andersen, wo nachts die Spielsachen wirklich das sind, was bei Tage nur mit ihnen gemeint ist. In einer Anderswelt sprechen Sinnbilder miteinander und fangen das Tanzen an, umarmen sich, verlieren sich oder streiten und sterben gar .. und werden anders neugeboren. Das klingt schon nach einem Versprechen, aber ob es mir auch gelingt und gelungen ist, Sprache öfter gezielt zu einem Eigenleben zu erwecken? Mancher Dichter kann das sicher besser.
Das Böse?
Ja. Heute sagt man lieber „Das Destruktive“. Sagen wir die Intriganz, die Fiesheit, hybride Kriegsführung und Infokrieg, Mafia, alternative Fakten, Unterdrückung, Korruption, all das. Das wird im Märchen als Fratze destruktiver Mächte sichtbar. Im Alltag verstellt und verleugnet sich das Böse ja konsequent. Wer begeht schon ohne Maske einen Überfall? Und das Böse beschuldigt immer die Guten Mächte, Unheil zu säen.
Im Vorfeld des Erscheinens dieses Bands wurde Ihre Sprache von den einen als bunt, voll der Wortspiele gelobt, andere brandmarkten sie fast, nannten Ihren Stil und Ihren Anspruch antiquiert. Wollen Sie darauf antworten?
Beiden Positionen bin ich jetzt erst einmal hilflos ausgeliefert. Ich sage mal so: Der Kunstsammler, der mit der Droschke im Frack, mit weißen Handschuhen und Zylinder auf dem Kopf vorfährt, wird zuerst mal meine Sachen auf Allgemeinplätze hin abklopfen. Und vielleicht den Kopf schütteln. Während die Gänsemagd sich einfach bezaubern lassen will, um zu einem einfachen Lied auf der Wiese selig zu tanzen. Damit kündige ich bereits an, in welche romantisch antiquierten Schubladen ich die Kritik zu stecken beabsichtige.
Ja, haha, wie anmaßend! Als ob es dazwischen nichts gäbe.
Genau, haha! Zwar …
Aber ein schönes Bild, das hat was. Es ist nämlich nicht unwahr!
Wenn Kritik konstruktiv ist, nach technischen Mängeln sucht, ist das ja nicht verkehrt. Zum Zeitpunkt der sogenannten Produktion konnte ich nicht besser.
Sie wollen niemand mit Ihrer Schreibe beeindrucken, Herr Palmenstein?
„Gut“ zu sein war nicht der Sinn meiner Schreibe. Das merkt man ihr auch öfter an. Fast würde ich gerne „leider“ sagen. Aber dieses „leider“ wäre fehl am Platze.
Ich finde, daß Ihre Texte einfach echt sind, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, aber … „Nörgelnder Kunstimpressario in Frack und Zylinder?“, „Tanzende Gänsemagd?“ Ich höre hier heraus, daß auch Grimms Märchen zu Ihrer bevorzugten Lektüre gehört haben könnten?
Ja, sicher … Märchen, auch die sogenannten Kunstmärchen. In den Märchen wird das Böse klar benannt. Auch zu Zeiten, wo es überall auf der Welt relativiert wird.
Das Böse?
Ja. Heute sagt man lieber „Das Destruktive“. Sagen wir die Intriganz, die Fiesheit, hybride Kriegsführung und Infokrieg, Mafia, alternative Fakten, Unterdrückung, Korruption, all das. Das wird im Märchen als Fratze destruktiver Mächte sichtbar. Im Alltag verstellt und verleugnet sich das Böse ja konsequent. Wer begeht schon ohne Maske einen Überfall? Und das Böse beschuldigt immer die Guten Mächte, Unheil zu säen.
Märchen sind immer aktuell. Ich denke gerade an die Stiefmutter, die das Schneewittchen vergiften will, die läßt nicht locker, ja. In immer neuen Verkleidungen kommt sie.
Und auch der Weg aus dem Verwunschenen zu einer Erlösung wird in den Märchen beschrieben. Etwa beim Eisenhans. Mir geht es nicht um gefälligen Kitsch, wenn ich Märchen auch heute noch vor meinem inneren Auge immer wieder mal Revue passieren lasse. Lesen muß ich die meisten ja nicht mehr, ich kenne die Handlung vieler Märchen quasi auswendig.
Liegt nicht gerade für Anthroposophen eine geheime Symbolik in einigen Ihrer Verse und Erzählungen, oder haben Sie in dieser Richtung etwas versucht? Wenn ich an die Teppichreise denke, die ja in teilweise ganz verrückt entrückten Welten spielt, voller Metaphorik, da konfrontieren Sie den Leser zum Schluß noch einmal ganz konkret mit einem Totenreich. Ist ihr Buch „Leuchtfeuer“ in Teilen ein verdeckt anthroposophisches Buch?
Zum Thema Anthroposophie, da könnte man auch ein Faß aufmachen. Klar, daß Sie die Frage nach Steiner im Zusammenhang mit der Frage nach den Märchen stellen. Märchen und Sagen haben in der Waldorfpädagogik eine gewisse Bedeutung. Märchen helfen Kindern zum mutigen Ergreifen der „Leibesgestalt“, und Sagen stärken den Mut Erwachsener, der Endlichkeit der physischen Existenz entgegenzusehen, heißt es da beispielsweise. Nein, das Buch ist kein anthroposophisches Buch, weder offen, noch verhüllt, auch wenn ein Anthroposoph manches, etwa die besagte Teppichreise nach der Denkweise der Anthroposophie deuten könnte. Die Bonbonwelt versinnbildlicht Luziferisches, das Industrie‐ und Fabrikenland Ahrimanisches. Könnte man da hineinsehen. Was ich langweilig fände. Immerhin ist die Teppichreise ein echter Traum gewesen, dessen Protokoll ich in eine Erzählung umzugießen versuchte.
Bei Steiner geht es doch öfter auch um sogenannte Höhere Welten, oder?
Der frühe Rudolf Steiner hat im übrigen noch nicht über – märchenhaft anmutende – Engelhierarchien und Naturwesen in Vorträgen gelehrt, sondern war eher ein nüchterner Philosoph. In Anthroposophischen Einrichtungen allerdings habe ich eine bedeutsame Zeit, einen wichtigen Lebensabschnitt verbracht. Waldorfschüler bin ich definitiv nicht, auch war mein Herkunftsmilieu kein anthroposophisches. Mitglied der Gesellschaft bin ich auch nicht, und war es auch nie. Allerdings erkenne ich problemlos ein typisch anthroposophisches Milieu am Dresscode, an einer speziellen Syntax im Sprechverhalten, an typischen Ängsten und Tabus, vertieft durch die Körpersprache, an der Ernährungseigenartigkeit, an der Gangart. Da sollte man nachsichtig sein. Aber das, was Steiner suchte und verwirklichen wollte, ist etwas ganz Anderes als Dresscodes, edle Hölzer und Pflanzenfarben in der Innenarchitektur usw. Für mich waren Anthroposophische Einrichtungen für eine Weile eine Alternative zur etablierten Welt. Denn die anthroposophischen Einrichtungen wurden einerseits belächelt, aber auch andererseits bewundert. Bewundert, weil sie eben produktiv waren. Biologischer Landbau, Alternative Medizin, und meditative Übungen. Ein Bekenntnis zu menschenfreundlicher Seriosität. Das waren Kriterien, die ich woanders in der alternativen Welt so nur selten finden konnte. Man wollte und man will auch heute noch wirklich echte Qualität anbieten. Darin soll viel menschliche Wärme erlebbar werden. Die sogenannten Waldorfschulen sind bis zum heutigen Tag für viele Menschen noch eine Alternative im Lernangebot.
Was war für Sie bei Steiner, den Sie in den „Leuchtfeuern“ kurz erwähnen, ihm ein Gedicht widmen, essentiell?
Daß er der Ansicht war, daß man niemandem gegenüber verantwortlich sei, außer sich selbst. Das war ein anarchistischer Gedanke, der mir gut gefiel. Dieser Gedanke aber hatte eine konkrete moralische Intention, und war mitnichten antisozial gemeint.
Anthroposophische Einrichtungen werden und wurden manchmal belächelt, aber auch kritisiert. Man spricht von antisemitischen und rassistischen Passagen in Steiners Werk und manches aus seinen Vorträgen aus dem Ersten Weltkrieg, wo Steiner über „Angloamerikanische Geheimlogen“ und deren angebliche Machenschaften schwadroniert. Diese werden heute gerade im Internet und bei Facebook immer wieder als „hellseherische und geheimwissenschaftliche“ Belege, ja, Beweise für eine Neue Weltordnung angeführt. Hat Sie das nicht gestört? Wurde sowas nicht thematisiert?
Es wurde in den 70er‐ und 80er‐Jahren nicht nur nicht thematisiert, es störte keinen, weil viele Menschen felsenfest davon überzeugt waren, wie ich übrigens auch, daß Steiner „einer von uns“ war, nämlich „links“, was damals sehr viel heißen konnte: Solidarität, Mitempfinden, Menschenfreundlichkeit, kein Rassismus, kein Antisemitismus, keine Homophobie, Naturschutz, viel viel Musik, Menschen kennenlernen, Humor haben und Lachen, und vor allem freundlicher und antiautoritaristischer Umgang miteinander! Das waren für einfache junge Leute dieser Tage die ungesagten und erwarteten Konnotate, wenn man meinte: „Ich bin irgendwie links halt, gell!“ Manche kannten doch von Marx nicht mehr als den Namen, falls sie kein Abitur hatten. Einige Freaks hatten Werke Steiners gelesen, in denen es um Selbsterziehung und um Erkenntnis Höherer Welten ging. Was scherten einen damals Antijudaismus oder Englische Logen. Für solche Themen allerdings war man bereits hellwach in Kreisen, für die beispielsweise Aleister Crowley, Macht und Magie interessant waren. Da las man bereits diesen für uns eher uninteressanten Steiner. Davon erfuhr ich erst, als ich gar nicht mehr in einer Anthroposophischen Einrichtung arbeitete, daß Steiner auch über diese Dinge soviel sagte. Steiner distanzierte sich auch vom Antisemitismus. Und vom Rassismus. Dennoch schaffte er es eben nicht immer, wirklich so seiner Zeit voraus zu sein, wie er es gern gewesen wäre. Und leider schlachtet man zurzeit seinen Nachlaß gerade dahingehend zu Propagandazwecken aus für eine Sache, die Steiner selber wohl definitiv nicht wollte, und die auch wir damals nie und nimmer unterschrieben hätten. Nämlich man instrumentalisiert Steinerzitate, die aus Steiners dunkelsten Stunden stammen, für identitäre und völkische Positionen, die gerade in der Syrienkrise und der Massenflucht 2015 enorm erstarkt sind. Jetzt sind wir aber weit vom Thema ab.
Tja, da haben wir ja so einiges über Sie erfahren, Herr Palmenstein. Ist Jim Palmenstein Ihr wirklicher Name?
Da zitiere ich mich mal selbst: Heißen wir Menschen überhaupt? Wir sammeln im Laufe unseres Lebens so einige Namen an.
Erwachsenwerden heißt, zum Zyniker zu werden, nicht?
Sie haben bisher nie, oder kaum veröffentlicht? Haben Sie Bedenken, daß man Ihnen die gefürchteten Allgemeinplätze nachzuweisen versucht?
Draußen im Wald spät nachts unter den Sternen, die ferne Sonnen sind, wenn man da nur einmal dreißig Minuten stille sitzt und über ein fernes Sternbild meditiert, da geschehen Dinge in der Seele, vor denen doch die meisten Menschen fliehen. Die Sterne zu besingen, das ist ein typischer Allgemeinplatz. Wenn mich die Sterne in meiner Seele berühren, wird es still in mir. Aus dieser Stille kann ein Gesang, können einige meditative Worte entstehen. Soll man das dann mit anderen teilen? Da bin ich mir nie sicher. Muschelschalen, von der Brandung umspült, leuchten, glänzen, und der ganze Ort, wo man sie findet, leuchtet auch. Nehme ich eine Muschelschale von dort mit nach Hause? Manchmal macht man es trotzdem.
Sie haben weit mehr geschrieben, als die Texte, die in den „Leuchtfeuern“ jetzt veröffentlicht wurden. Darunter auch einen Roman, der Freundschaft, enttäuschte Liebe, Illusionen, Mobbing, Lügen und das Erwachsenwerden thematisiert.
Erwachsenwerden heißt, zum Zyniker zu werden, nicht?
Das haben Sie gesagt! Haha, ich weiß, was Sie damit sagen wollen. In ihrem Roman „Das Blaue Meer“ geht es auch ein bißchen um die Alternativszene der Achtziger.
Eigentlich um alle Menschen. Nicht bloß um späte Hippies. Wer waren denn „die Alternativen“, die „Andersgeborenen“? Oft waren es einfach Menschen, die, etwas verkürzt gesagt, durch unterschiedliche Traumata in der Gesellschaft nicht mehr ganz ernst genommen worden waren, oder quasi als Psychos und Simulanten ausgelächelt wurden. Die taten sich manchmal in spirituellen Zirkeln zusammen, feierten innige Gottesdienste im Freien draußen, beteten unter den Sternen, umarmten Bäume, lagerten gern an sogenannten Kraftplätzen, machten dort nachts ein Feuer, wo sie Wein tranken, Selbstgedrehte rauchten, waren ehrlich und offen miteinander, beichteten sich ihre Wunden und Fehler! Manche fuhren auch gerne Motorrad, und klar, machten auch gern mal einige grenzwertige Orgien und bei schlimmen Sachen mit. Es waren Menschen, die sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlten, kein konventionelles Familienleben kannten, und in Beziehungen schnell mal überfordert reagierten. Die sich untereinander halfen, miteinander offen waren und sich seelisch unterstützten. Sich aber immer wieder schmerzlich zerstritten. Sie waren meistens schlecht organisiert, und ohne Disziplin. Einige schafften den Sprung in die Selbständigkeit, weil sie ihre Ideen unablässig und verbissen verfolgten. Aber in einigen blieb immer und immer noch die Bitterkeit über eine empfundene Ausgrenzung zurück. Und die gingen dann instrumentalisiert durch Seiten und Videos im Internet über zu den Populisten und erhoffen sich von dort Rettung vor dem zum Feindbild geronnenen „Establishment“, den „Eliten“, vor denen man sich so oft geschämt hat, weil man halt nicht die Bildung, den Erfolg hatte. Früher lebte ich sehr gern unter Outlaws, wenn es denn keine Kriminellen waren. Menschen, die nur ein Schicksal hatten, worüber sie zu berichten wußten. Und nicht einen vorgeschriebenen Lebenslauf abgearbeitet hatten, um auf all ihre Titel, Preise, Referenzen und Auszeichnungen aufmerksam zu machen. Leider entwickeln sich einige unkonventionelle Menschen irgendwann nicht mehr weiter, und lassen sich selbst verwahrlosen. Der Roman Das Blaue Meer handelt vom Erwachsenwerden, aber auch von der Entwurzelung und dem Verlust der Beheimatung und einer ganz ursprünglichen Naivität und kindlichen Zutraulichkeit: Von Freundschaften, die nicht aus Kalkül und wegen der Begründung von Seilschaften geschlossen werden.
Draußen im Wald spät nachts unter den Sternen, die ferne Sonnen sind, wenn man da nur einmal dreißig Minuten stille sitzt und über ein fernes Sternbild meditiert, da geschehen Dinge in der Seele, vor denen doch die meisten Menschen fliehen. Die Sterne zu besingen, das ist ein typischer Allgemeinplatz. Wenn mich die Sterne in meiner Seele berühren, wird es still in mir. Aus dieser Stille kann ein Gesang, können einige meditative Worte entstehen. Soll man das dann mit anderen teilen? Da bin ich mir nie sicher. Muschelschalen, von der Brandung umspült, leuchten, glänzen, und der ganze Ort, wo man sie findet, leuchtet auch. Nehme ich eine Muschelschale von dort mit nach Hause? Manchmal macht man es trotzdem.
Könnte eventuellen Kritikern Ihre Sprache und die von Ihnen bevorzugten Themen auch zu blumig, zu mehrdeutig sein? Ganz konkrete Texte, ohne Metaphern sind ja schwerer zu realisieren, und arbeitsintensiver. Sie sagten selbst einmal, mehrere Metaphern kühn hintereinandergeschaltet, etwa Herz, Dornen, Spiegelsplitter, Schwarze Wolken und Rostende Boote, Meeresgrund und nun noch paar verbindende Verben und, Sim Sala Bimm, ein dramatisches Liebesgedicht ist produziert!
Haha, genau. Das funktioniert. Und nach dem Posten regnet es Herzen und Däumchen bei Facebook. Nur, ich weiß gar nicht, ob ich so blumig schreibe. Das Abenddämmerland ist mir ein wenig zu blumig geworden. Ansonsten finde ich meine Texte mitnichten zu üppig. Nun, wenn man exakt Fakten vermittelt, diese knapp auf den Punkt bringt, ist das eine gute Übung. Geeignet für die Dokumentation. Ich habe aber oft erlebt, wie sehr mir Worte fehlten, wo ich so gern Eindeutiges gesagt hätte. Ein Zustand großer Ohnmacht und Zersplitterung. Das ist oft in zwischenmenschlichen Unvereinbarkeiten der Fall. In Freundschaften. In Beziehungen. In der Liebe. Aber auch bereits inmitten banaler Arbeitsverhältnisse. Alles Wesentliche verdichtet sich nur noch zwischen den Zeilen. In solchen Schwebezuständen entstehen Alpträume, aber auch orientierende Träume. Wenn man in solchen Situationen versucht, vernünftige Erklärungen abzugeben, tönen die wie Glocken ohne Klang. Hier kann ich nur versuchen, mehrschichtig und auf keinen Fall mehr rational zu formulieren. Wenn Glocken erklingen sollen, müssen sie frei schwingen können …
Herr Palmenstein, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Die Fragen stellte Paul Klingenberg. Das Interview wurde ursprünglich veröffentlicht am 31. August 2018 auf der alten Homepage des Verlag Klingenberg und im Bikinifisch.